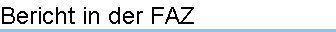
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. April 2000
Durchhungern
nach der Odyssee
Noch immer harren Flüchtlinge aus Ruanda in kenianischen Lagern aus
von Thomas Scheen
NAIROBI, 25. April. Laurence Nyirahabimanas ganzer Besitz liegt auf dem
Boden des drei mal drei Meter großen Bretterverschlags, den sie ihr Heim
nennt: Ein Wasserkanister, drei Metallschüsseln, eine Plastiktüte mit
fadenscheinigen Kleidungsstücken, eine schimmelige Matratze. Ihre Füße
stecken in verschlissenen, viel zu großen Turnschuhen, sie trägt ein
löchriges T-Shirt, und wenn sie mit stockender Stimme ihre Geschichte
erzählt, fasst die knöchrige Hand mechanisch nach dem Rosenkranz, der um
ihren Hals baumelt.
Die 56 Jahre alte Hutu-Bäuerin aus Ruanda gehört zu den Vergessenen
eines der blutigsten Kriege der neunziger Jahre. Als 1994 eine Rebellenarmee
in Ruanda einmarschierte und dem Völkermord an den Tutsi ein Ende machte,
flohen hunderttausende Hutu aus Angst vor Rache in die Nachbarländer Kongo
und Burundi. Darunter Laurence, die mit ansehen musste, wie ihre sechs Kinder
und ihr Mann von Tutsi-Soldaten ermordet wurden.
Was folgte, war eine Odyssee, wie sie viele Ruander in Nairobi erzählen
können: Flüchtlingslager in Kongo und Burundi, Flüchtlingslager in
Tansania, Endstation Kenia. 16 000 Ruander. überwiegend Hutu, leben heute in
Kabiria, einem Slum am Rande von Nairobi. Die kenianische Regierung nimmt die
Ruander nur dann zur Kenntnis, wenn Wahlen anstehen und ein Lokalpolitiker
Tatkraft demonstrieren will. Dann jagt in Kabiria eine Polizei-Razzia die
nächste. „Die Menschen sind hier vollkommen rechtlos‘. sagt der
Benediktinerpater Peter Meienberg. der sich der Flüchtlinge angenommen hat.
Der hagere Schweizer kennt all die Geschichten, die klingen wie aus einem
vergangenen Jahrhundert.. Die Massenmorde in Ruanda, die monate-langen
Fußmärsche durch den kongolesischen Regenwald, das Elend und die Gewalt in
den Flüchtlingslagern. Meienberg weiß von den Verhaftungen der illegal in
Kenia Lebenden, die im Gefängnis enden, nur weil sie kein Geld haben. die
Polizisten zu bestechen.
Julienne Uwikubire hat einen Traum: einen Marktstand, an dem sie
Kartoffeln und Tomaten verkaufen kann. Doch dafür braucht sie Startkapital,
eine Arbeitserlaubnis und gute Kontakte. Julienne hat nichts dergleichen.
Genau genommen hat die 24 Jahre alte Hutu-Frau nicht einmal‘ genug Geld, um
ihren zwei Jahre alten Sohn zu ernähren. 500 kenianische Schilling
(umgerechnet 15 Mark) zahlt sie für ihre Unterkunft, durch deren Wandritze
der Wind pfeift. Sie arbeitet gelegentlich als Wäscherin, aber mehr als 100
Shilling bringt das monatlich nicht ein. Also bettelt sie wie alle in Kabiria.
Auf die Frage, was sie heute gegessen habe, zuckt sie mit den mageren
Schultern: einen Becher Uchi, ein Getränk aus Maisbrei, das sättigt, ohne
nahrhaft zu sein, und den Bauch aufbläht wie einen Ballon.
„Durchhungern" nennt Meienberg das. Siebzig Familien versorgt er
einmal wöchentlich mit den Grundnahrungsmitteln Mais und Mehl. Zudem
organisiert und finanziert er den Schulbesuch von sechzig Kindern. Die
Benediktiner betreiben in ihrer Pfarrei Fortbildungskurse für Frauen, in
denen diese zu Sekretärinnen und Friseurinnen ausgebildet werden.
Daimler-Chrysler schickte fünfzehn ausrangierte Computer, die für Meienberg
wie ein Geschenk des Himmels waren. Zudem will er ein Haus kauten in dem
Hutu-Frauen und Tutsi-Frauen gemeinsam leben und lernen können. „Da haben
sie wenigstens ein bisschen Ruhe", sagt Meienberg. Er würde gerne noch
mehr tun, aber seine finanziellen Mittel sind beschränkt, weil seine Arbeit
auf Spenden angewiesen ist.
Marie-Agnes Nshimiyimana lächelt, wenn sie von ihrem Albtraum erzählt.
Als ob die leisen Worte sie schützen könnten, von der Erinnerung
überwältigt zu werden. Nur weil damals gerade Schulferien waren und sie bei
einer befreundeten Familie Urlaub machte, entging sie dem Massaker, das
Soldaten an ihrer Familie verübten. Mit ihrer Gastfamilie floh sie nach
Kongo. Sie wurde schwanger von ihrem Adoptivvater und bekam Prügel, weil sie
nicht abtreiben wollte. Sie floh ein zweites Mal, und als sie endlich in
Nairobi ankam, gebar sie Zwillinge. Erika und Eugenie heißen die Mädchen,
sind zwei Jahre alt und chronisch unterernährt. Ihre zwanzig Jahre alte
Mutter, die sagt, sie würde gerne Abitur machen und studieren, besitzt nicht
einmal eine Matratze, auf die sich die Kinder legen könnten. Marie-Agnes hat
versucht, nach Ruanda zurückzukehren. Doch das Haus ihrer Familie wir
längst besetzt, ihre Angehörigen spurlos verschwunden, und sie hatte Angst.
in Ruanda zu sterben. Also hat sie es irgendwie zurück nach Nairobi
geschafft.
Zwar betont die neue Regierung in Kigali, die Flüchtlinge hätten bei
ihrer Rückkehr nach Ruanda nichts zu befürchten, Sofern sie sich keines
Verbrechens schuldig gemacht hätten. Doch die Hutu in Nairobi schenken dem
keinen Glauben. „Dort verschwinden die Menschen einfach", sagt Erneste
Sekanabo, ein 22 Jahre alter Hutu aus Butare. Sein Bruder war Mitglied der
ruandischen Armee FAR. die am Genozid beteiligt war und vor den
Tutsi-Rebellen nach Kongo floh. Über Tansania kehrte der Bruder nach Ruanda
zurück, wo er unter ungeklärten Umständen getötet wurde. Erneste
behauptet, er wisse nicht, ob sein Bruder einer der „genocidaires"
gewesen ist, also jemand, der an den Morden beteiligt war. Was er aber weiß,
ist, dass sein Vater für seinen Sohn ins Gefängnis kam und seitdem
unauffindbar ist. Erneste geht nicht zrrück nach Ruanda. „Nicht, solange
dort kein Frieden herrscht."
Laurence fingert in den Taschen ihres weiten Rocks und fördert ein
zerfleddertes Papier zutage. Das Dokument trägt den Stempel des
Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen UNHCR. Es bescheinigt Laurence, dass
sie seit Februar 1999 registriert ist und sich im Mai 2000 wieder in der
Dienststelle einfinden soll, damit über ihren endgültigen Status als
Flüchtling entschieden wird. Sechzehn Monate banges Warten. Dabei sind ihre
Chancen auf Anerkennung verschwindend gering. Die kenianische Regierung
argumentiert, die Ruander müssen ihre Anträge in dem Land stellen, das sie
als erstes nach ihrer Flucht aus Ruanda betreten haben. Laurence kam über
Burundi. Doch in Burundi herrscht Bürgerkrieg. Hutu gegen Tutsi. Laurence
sagt, sie wolle am liebsten sterben. „Dann hätte ich endlich
Frieden".

[ Projekte ] [ Ich möchte helfen ] [ Peter Meienberg ] [ Hintergrund ] [ Newsletter ] [ Kontakt ]
